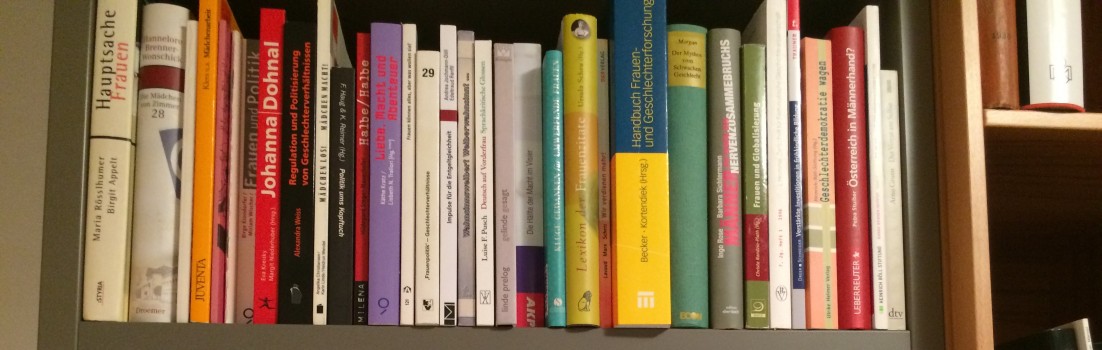Das Einigungsprojekt Europa hat in der Krise Risse bekommen. Wenn wir die Spaltung verhindern und für eine Vertiefung der Union eine Mehrheit in der Bevölkerung erreichen wollen, brauchen wir einen Kurswechsel. Ein neuer Aufbruch für Europa, der die Krise zurückdrängt, weil er sich an dem orientiert, was sozial wünschenswert und wirtschaftlich vernünftig ist, hätte die Chance auf eine viel breitere Zustimmung. Das wäre eine Europapolitik die auf ‚Hoffnungen und nicht auf Ängste’ setzt. Sie ist für mich eine lohnende Alternative. Der Fiskalpakt steht diesem europapolitischen Kurswechsel im Weg. Darum habe ich nach vielen Erwägungen mit ‚Nein’ gestimmt.
Die Presse hat mich um einen Kommentar zu meinen Nein gebeten.
Am 4. Juli wurde im Nationalrat der Fiskalpakt beschlossen. Bei der namentlichen Abstimmung habe ich mit Nein votiert. Das hat, weil ich Abgeordnete einer Regierungsfraktion bin, für einige Reaktionen gesorgt hat.
Meine Zweifel haben früh eingesetzt. Bereits die kurze Zeit in der ein so weitreichendes Vertragswerk zur Beschlussfassung ausformuliert wurde, gibt zu denken, weil parlamentarische Rechte eingeschränkt und an die Kommission übertragen werden. Einige neue Instrumente verfügen über keinerlei Rechtsgrundlage im Vertrag über die Europäische Union, weil der Fiskalpakt außerhalb der EU-Verträge steht. Als Staatsvertrag umgeht er auch die Arena des Europäischen Parlaments.
Bemerkenswert ist außerdem, wie Regierungs- und Staatschefs bei EU-Gipfeln Beschlüsse, die eine Verfassungsmehrheit ihrer Parlamente benötigen, im Voraus zusichern, obwohl sie oft keine eigene Verfassungsmehrheit im jeweiligen nationalen Parlament hinter sich haben. Das setzt – bei allem Bekenntnis zur Überzeugungsarbeit als Wesensmerkmal der Politik – den parlamentarischen Meinungsbildungsprozess enorm unter Druck.
Begründet wird die Geschwindigkeit mit dem Drängen der ‚Märkte’ und der Alternativenlosigkeit von Fiskalregeln. Als Sozialdemokratin habe ich zu der von Margaret Thatcher ausgerufenen T.I.N.A-Parole (‚There is no alternative’) eine große Distanz, aber darüber hinaus wird Politik, die zusehends Beschlüsse für alternativenlos hält, in ihren Entscheidungsprozessen unterspült. Demokratie ist anstrengend und oft aufwändig, aber sie lebt davon, dass wir über Alternativen verhandeln, abwägen und abstimmen. Sind Beschlussvorlagen alternativenlos, erübrigt sich das Parlament als demokratischer Verhandlungsraum. Dann wäre auch die Frage ob wir 183, 165 oder 100 MandatarInnen im Nationalrat sind, unerheblich.
Sie ist aber nicht unerheblich. Vielmehr sind Entscheidungsfindungsprozesse in demokratisch gewählten Gremien und Parlamenten, die unter dem Damoklesschwert von Sachzwang und Zeitdruck “der Märkte” geführt werden, grundsätzlich problematisch. Sie messen in dieser Logik dem “Vertrauen” einzelner Interessengruppen, die hinter diesen Märkten stehen, tendenziell mehr Bedeutung bei als dem Vertrauen der Menschen, die diese Gremien zur Wahrung ihrer Interessen und der gesamten Gesellschaft gewählt haben.
Vor diesem Hintergrund sind jene Analysen zentral, die den Fiskalpakt als ‘falsche Therapie zur falschen Diagnose’ einstufen. Sie eröffnen einen neuen Blick auf die Lage und erweitern den notwendigen Handlungsspielraum. Die Staatsverschuldung und die damit verbundenen hohen Zinsaufschläge werden gemeinhein als Krisenursache festgemacht. Das ist ein erster Teil der falschen Diagnose. Der Zusammenhang von Staatsverschuldung und Zinssätzen ist widerlegt, wie sich an Japan, USA, Spanien oder Deutschland nachweisen lässt. Japan ist mehr als doppelt so hoch verschuldet wie Deutschland, kann sich jedoch an den internationalen Kapitalmärkten Geld zum halben Zinssatz leihen. Die Verschuldung der USA entspricht jener Südeuropas, die Zinssätze der Vereinigten Staaten liegen aber knapp über jenen Deutschlands.
Die Ursache für die seit der Finanzkrise dramatisch auseinanderlaufenden Zinsen sind nicht der Schuldenstand der öffentlichen Haushalte, sondern die immer größeren Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Der Norden, ganz besonders Deutschland, baut Exportüberschüsse auf, die sich in den Defiziten der südlichen Länder widerspiegeln. Ihren Ursprung hat diese Entwicklung in der ‚Lohnzurückhaltung’ und Durchlöcherung der einheitlichen Tarifregeln in Deutschland genommen, die den Gewerkschaften durch den Druck der Agenda 2010 (Stichwort Hartz IV) abgepresst werden konnten. In Südeuropa unterschätzte man jahrelang die Bedeutung gesamtwirtschaftlicher Lohnstückkosten für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes in einer Währungsunion und ließ die Löhne zu stark steigen. Für das Funktionieren einer Währungsunion, in der nicht mehr gegeneinander abgewertet werden kann, ist aber die permanente Einhaltung der vereinbarten Inflationsrate und Lohnstückkostenentwicklung und zwar nicht nur im Länderdurchschnitt, sondern in jedem einzelnen Land zentral. Wird dieser Grundsatz dauerhaft missachtet, kommt eine Währungsunion unter Druck.
Der Lohndumping-Wettbewerb und die nach wie vor praktisch ungebändigten Finanzmärkte haben Europa in höchste Bedrängnis gebracht. Genau dort muss die Therapie ansetzen. Eine andere Therapie scheint auch dringend geboten. Die bisher verordneten Ausgabenkürzungen in den Krisenländern sind von ansteigender (Jugend-)Arbeitslosigkeit, Massenstreiks, Gefährdung sozialer Sicherungssysteme und massiven Lohn- und Rentenkürzungen begleitet. Der Fiskalpakt verordnet Südeuropa ‚more of the same’ und führt Nordeuropa durch die Handelsverflechtung in eine Abwärtsspirale. Das ist sozial unzumutbar und wirtschaftlich unvernünftig.
Der Fiskalpakt verlangt, dass alle Staaten nun gleichzeitig sparen und Defizite abbauen – und zwar genau zum falschen Zeitpunkt, nämlich im Abschwung. Der im Juni beschlossene Wachstumspakt der EU ist im Verhältnis zu den bereits vorgenommenen und noch geplanten Sparvolumina viel zu gering, um die Folgen der Kürzungsprogramme auch nur ansatzweise auszugleichen und er löst nicht die Ungleichgewichte der Handelsbilanzen als zentrales Krisenproblem.
Bedeutsame ÖkonomInnen, die alleine schon deswegen glaubwürdig sind, weil sie seit Jahren davor warnen, was nun Europa plagt, fordern einen Richtungswechsel, also das rasche Ende der desaströsen Sparpolitik. Damit der Weiterbestand der Währungunion gesichert ist, müssen Ungleichgewichte abgebaut und die Preisniveaus bzw. Lohnstückkosten langsam angeglichen werden. Das kann nur durch koordinierte Lohnsteigerungen erreicht werden. Eine Anpassung nach unten würde in eine deflationäre Abwärtsspirale führen. Die Hebung der Binnennachfrage ist die beste Barriere dafür. Die Schließung der Finanzmarktcasinos durch ein Verbot von gefährlichem Derivatehandel muss den brandgefährlichen Spekulationen gegen Staaten ein Ende setzen. Das ist – keine Frage – ein ambitioniertes Programm. Es läuft auf einen Fluchtpunkt zu: die Währungsunion sichern und dabei das Vertrauen der Menschen in die Lösungskomptenz der Politik wiederherstellen.
Das Einigungsprojekt Europa hat in der Krise Risse bekommen. Wenn wir die Spaltung verhindern und für eine Vertiefung der Union eine Mehrheit in der Bevölkerung erreichen wollen, brauchen wir einen Kurswechsel. Ein neuer Aufbruch für Europa, der die Krise zurückdrängt, weil er sich an dem orientiert, was sozial wünschenswert und wirtschaftlich vernünftig ist, hätte die Chance auf eine viel breitere Zustimmung. Das wäre eine Europapolitik die auf ‚Hoffnungen und nicht auf Ängste’ setzt. Sie ist für mich eine lohnende Alternative.
Der Fiskalpakt steht diesem europapolitischen Kurswechsel im Weg. Darum habe ich nach vielen Erwägungen mit ‚Nein’ gestimmt.