Vor einiger Zeit hat mich jemand gebeten, meine Erinnerungen an die Friedensbewegung als ich Jugendliche war, aufzuschreiben. Sie sind eng mit Johanna Dohnal verknüpft. Heute an ihrem Geburtstag sind sie mir wieder untergekommen.
“Wissenschafter warnen: Atomkrieg noch vor dem Jahr 2000″. Das war’s. Ende. Ich wollte Entwicklungshelferin werden und zwölf Kinder haben. Auch einen Hund und ein Pferd. Aus der Traum. Ich war 14 und wie vor den Kopf geschlagen.
Diese Schlagzeile der Oberösterreichischen Nachrichten im Jahr 1980 hat mich voll erwischt. Für Tage und Wochen hat mich nichts so sehr beschäftigt wie diese Warnung. Eine real empfundene Bedrohung. Mit meiner Mutter kaute ich das Thema immer wieder durch. Es scheint mir heute im Rückblick überraschend, wie sehr mich die mediale Berichterstattung über die nukleare Bedrohung beeinflusste, aber ich erinnere mich sehr genau, wie unruhig ich schlief in diesen Tagen. Ich wachte oft mit dem Gedanken auf, wieder einen Tag näher an die Katastrophe herangerückt zu sein.
Nie zuvor hat mich etwas so beunruhigt und verschreckt. Zukunftsangst war mir völlig fremd. Ich wuchs als Kreisky-Kind in einer sozialdemokratischen Familie auf. Wir alle waren Kreisky-Fans. Bei mir ging es so weit, dass ich im Zeichenunterricht der Volksschule Wahlplakate mit “Kreisky – wer sonst?” malte, die meine Lehrerin mit mildem und zugegebenermaßen auch etwas mitleidigem Lächeln entgegennahm.
SPÖ-Politik, “Kreisky und sein Team” waren Thema bei uns zu Hause. “Der Kreisky, der schaut auch auf uns Arbeiter”, versicherte mir mein Vater immer wieder. Dieses Versprechen bestand auch tatsächlich den Praxistest. Wir waren ein Arbeiter- bzw. kleiner Beamtenhaushalt: Mutter, Vater, Großvater und vier Kinder. Große Sprünge waren also nicht drin. Aber Schritt für Schritt kam ein bisschen Luxus in unser Leben: ein Auto, Fahrräder für uns Kinder, ein Urlaub im Ausland. Als Jüngste durfte ich nach der Hauptschule in ein Gymnasium gehen und sogar Reitstunden nehmen. Ein ziemlicher Sprung für ein Kind, dessen Eltern Schulwarte waren und nur acht Jahre Volksschule besuchen durften.
Ich sah nicht alles durch eine rosa Brille, aber mit gewisser Zuversicht. Ein wenig fühlte ich mich wie Isabella aus Mira Lobes Räuberbraut[1]. Die 13-jährige Mathilde (Tilli) Meier führte als Tochter einer Hausfrau und eines Buchhändlers zwar ein wenig aufregendes Leben, aber nachts, in ihren Träumen bekämpfte sie als Isabella della Ponte mit ihrem Räuberhauptmann Don Diego Hunger, Armut, Ölkatastrophen und Ungerechtigkeit. Die Welt war nicht heil, aber ich hatte das Gefühl, dass man – und ein wenig auch ich – sie besser machen konnte. Ich engagierte mich in einer kritischen Jugendgruppe der katholischen Jugend und bastelte an meiner Identität. Punks waren irgendwie cool, Popper mit ihren Fiorucci-Karottenjeans und College-Schuhen overdressed (ehrlicherweise hätte mein Taschengeld auch für diesen Dresscode nie gereicht). Mit der Ankündigung des drohenden Atomkrieges waren meine Zuversicht und meine “Kreisky-schaut-auf-uns”-Sicherheit weggefegt.
Dass Bruno (wie ihn meine Mutter nannte) den Atomkrieg verhindern hätte können, traute ich ihm trotz größter Achtung nicht zu. Ich stöberte durch Zeitungen und begann mit Leidenschaft Flugblätter der Friedensbewegung zu studieren. Ein älterer Freund gab mir einen Zeitungsartikel, der mich abermals beunruhigte. Frank Barnaby, Direktor des Stockholmer Friedensinstitutes schrieb damals in der Zeit: “Der Atomkrieg rückt näher.” Denn, so begründete er: “Niemand vermag zu sagen, wann genau ein atomarer Weltkrieg ausbrechen wird, wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher. Aber der Pessimismus jener, die einen Konflikt noch vor dem Jahr 2000 erwarten, scheint mir durchaus gerechtfertigt zu sein.” Der Atomkrieg wurde zur realen Gefahr, weil die neue Generation strategischer Nuklearwaffen einen Atomkrieg “führbar” machte und er damit “gewinnbar” sei.
Ein Atomkrieg war wahrscheinlich, weil er angeblich zu gewinnen war. Es war eine bestechende und extrem belastende Logik. “Den Rüstungswahnsinn beenden”, forderte die Friedensbewegung. Das war die einzig richtige Antwort darauf. Sie entsprach auch meiner aufkeimenden Unsicherheit, dass Frieden doch nicht “im Kleinen beginnt”, wie manche Kirchenvertreter rund um meine katholische Jugendgruppe uns erklärten. Beten für den Frieden fand ich irgendwie nicht überzeugend. Noch viel mehr, als ich die Zahlen in Barnabys Analyse las, wonach der Waffenhandel “mittlerweile einen Reingewinn von jährlich 30 Milliarden Dollar” abwarf. Gebete erschienen mir als Gegenrezept inadäquat und ein wenig zu “wolkig”. Die Friedensbewegung allerdings interessierte mich immer mehr. Gerade weil sie genau das zum Thema machte, was mich in Angst und Schrecken versetzte: die atomare Hochrüstung und mein Horror vor einem Atomkrieg.
“Dass die Welt voller Bomben ist, soll uns ja beruhigen. Die Sprengkraft reicht aus, um hochgerechnet 100 Milliarden Menschen umzubringen, die Frage ist nur, wo kriegen wir so viele Menschen her? Es ist ja inzwischen kein Mangel an Waffen mehr, die Menschheit zu vernichten. Es reicht vielmehr die Menschheit, die vernichtet werden könnte, nicht mehr für die Waffen aus.” Ein vielfaches Hiroshima also. Johanna Dohnal zitierte bei der Abschlusskundgebung des Friedensmarsches in Linz im November 1981 die feministische Theologin Uta Ranke-Heinemann. Diese hatte kurz davor bei der großen Friedensdemonstration in Bonn den mörderischen Wahnsinn des “Overkills” in seiner ganzen Dimension drastisch dargestellt. Und sie sprach genau an, was mich aufregte, aber gleichzeitig ohnmächtig machte.
Johanna Dohnal erklärte mir sozusagen, auf meiner ersten Demonstration, dass meine Angst nicht unbegründet war. Das tat gut. Die Friedensbewegung tat mir und meiner Angst gut. Heute weiß ich, dass bei diesem Friedensmarsch am 6. November in Linz mehrere Tausend Menschen teilnahmen: Alte und Junge, GewerkschafterInnen, SozialdemokratInnen, ChristInnen, KommunistInnen und einfach besorgte BürgerInnen. Diesen Überblick hatte ich damals nicht, aber ich erinnere mich daran als ein Ereignis, wo SeniorInnen und Teenager nebeneinander marschierten. Auch daran, wie so manche ältere Demo-TeilnehmerInnen uns wohlwollend zublinzelten und uns ermunterten, weil wir ja “für unsere Zukunft” hier stehen. Meine erste Demonstration – und irgendwie fühlte ich mich in den Fußstapfen Isabella della Pontes, allerdings im wirklichen Leben.
Dabei hätte ich fast nicht teilnehmen dürfen an dieser Friedensdemo. Meine Mutter wollte es mir nicht erlauben. Demonstrationen galten ihr nicht ausschließlich als friedvolle und ungefährliche Ereignisse, und irgendwie war ihr zu Ohren gekommen, dass die Friedensbewegung kommunistisch unterwandert sei. Das Ganze schien meiner Mutter keine geeignete Freizeitbeschäftigung für eine 15-Jährige zu sein. Nur die Zusicherung, dass uns der geistliche Assistent meiner KJ-Gruppe begleitete, konnte meine Mutter umstimmen. Dass Johanna Dohnal dort sprach, wusste ich nicht als Joker einzusetzen.
Dass Johanna Dohnal dort sprach, war allerdings – auch im Rückblick betrachtet – ein Joker. Mit der Teilnahme einer prominenten sozialdemokratischen Politikerin, wie der Frauenstaatssekretärin Johanna Dohnal, an dem Linzer Friedensmarsch, war innerparteilich die Friedensbewegung nicht mehr nur eine (nicht gern gesehene) Angelegenheit der eigenen Jugendorganisationen und ein paar “naiver Träumer” oder KommunistInnen. Die Friedensbewegung entsprach der Friedenssehnsucht von Millionen Menschen in Europa. Johanna Dohnal erkannte das und warb für ein Engagement der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Friedensbewegung. Sie wollte die Zusammenarbeit und hielt es für notwendig, dass sich die SPÖ dieser Bewegung öffnete. Sie war auch federführend daran beteiligt, dass die SPÖ-Frauen 1981 einen Friedensarbeitskreis gründeten, der auch Nicht-Parteimitglieder zur Mitarbeit einlud.
Johanna Dohnal war erste Vorsitzende des Arbeitskreises. Sie wollte die SPÖ-Frauen glaubwürdig in der politischen Friedensarbeit verankern und sichtbar machen, dass deren Bekenntnis zum friedenspolitischen Engagement über Ansprachen und Appelle hinausging. Das war keine leichte Aufgabe, denn die SPÖ lehnte offiziell ein Engagement in der Friedensbewegung ab. Das galt auch für die Bundesorganisation der SPÖ-Frauen, die zwar prinzipiell für Friedensengagement und Friedenserziehung eintraten, aber der Friedensbewegung gegenüber zurückhaltend blieben und später keinen Aufruf zu den großen Friedensdemonstrationen unterzeichneten (Johanna Dohnal wurde erst 1987 zur Bundesfrauenvorsitzenden gewählt).
Die SPÖ begründete ihre Distanziertheit zur Friedensbewegung letztlich mit der sogenannten Eisenstädter Erklärung[2]. Diese Deklaration wurde 1969 im Geist des Kalten Krieges und vor dem Hintergrund des Einmarsches der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei formuliert. Die Erklärung stand für die programmatische Abgrenzung zum Kommunismus. Eine Zusammenarbeit mit der KPÖ wurde abgelehnt und – in dieser Logik – auch eine Beteiligung an einer Plattform wie der Friedensbewegung, die gleichermaßen von der KPÖ mitgetragen wurde.
Entgegen dieser Parteilinie unterstützte Johanna Dohnal die Friedensbewegung. Bei der Bundesfrauenkonferenz 1982 begründete sie die Notwendigkeit der politischen Friedensarbeit für die Frauen: “Es ist für uns selbstverständlich, daß uns verbale Aussagen und Appelle nicht genügen, wir wollen praktische, politische Arbeit, Bewußtseinsarbeit leisten, (…) erst (…) wenn wir wissen, was wir wollen, (…) können wir glaubwürdig (…) unseren Standpunkt vermitteln und all jenen eine Plattform geben, die mit uns übereinstimmen.”[3] Das war auch als eine Antwort auf die Frage zu verstehen, wie die SPÖ und insbesondere die SPÖ-Frauen ihr Verhältnis zu neuen sozialen Bewegungen entwickeln sollten. In Johanna Dohnals Verständnis musste eine progressive Volkspartei, als solche sie die SPÖ sah, Bündnisse mit einer kritischen Öffentlichkeit herstellen und vielmehr den Austausch, nicht die Abschottung dringend suchen. Die Friedensbewegung war eine eindrucksvolle Bewegung geworden. Sich daran zu beteiligen, ihre Anliegen aufzugreifen und sie auch in die innerparteilichen Diskussions- und Entscheidungsprozesse aufzunehmen, konnte eine Chance und Herausforderung sein, der man sich stellen und von der man inhaltlich profitieren konnte – eine richtige Positionierung, die an Aktualität nichts verloren hat, finde ich.
Der nach außen offene Friedensarbeitskreis der SPÖ-Frauen, den Johanna Dohnal gründete, war so gesehen die Praxis zur Theorie und ebenso die bald jährlich und in ganz Österreich stattfindenden Friedenswochen. Diese waren eines der wichtigsten Projekte des Arbeitskreises und festigten damals die Friedensarbeit der SPÖ-Frauen. Als ich mich in jener Zeit immer mehr in der Sozialistischen Jugend engagierte und der Kirche den Rücken zukehrte, waren die Friedenswochen im Herbst mit ihren Straßenaktionen, Informationsbustouren, Lesungen oder Unterschriftenaktionen mindestens so wichtig wie der Internationale Frauentag am 8. März.
Eine der Nachfolgerinnen als Arbeitskreisvorsitzende war einige Jahre danach meine spätere Schwiegermutter, die damalige Linzer SPÖ-Frauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Edith Dobesberger. Sie war Lehrerin und hatte ein gutes Gespür für die Übersetzung großer gesellschaftlicher Fragen in klar verständliche Botschaften. Außerdem sah sie in der Friedensarbeit die Chance, die weniger politisch bewussten Frauen in der SPÖ und beim SPÖ-nahen Pensionistenverband zu aktivieren und hatte dabei die “berühmten”[4] Bastelrunden im Blick. Sie entwickelte Pläne und Strickanleitungen und übertrug Friedensparolen auf Schnittmuster, die sie mit friedenspolitischen Anmerkungen verteilte. Und ich, mittlerweile junge SJ-lerin, selbsternannte Radikalfeministin und Freundin ihres Sohnes, war als Model auserkoren. Also ging ich nun in politisch korrekten Pullovern und Röcken aus dem Haus. Ich lief in bunten Garnpullis, die groß “Frieden schaffen – ohne Waffen” eingestrickt hatten, oder in Röcken mit “Frauen fordern Abrüstung” auf weißen Rockbordüren – es war eine harte Prüfung. Die Seniorinnen in den Frauencafés waren begeistert. Sie strickten und nähten für die weltweite Abrüstung und gegen Atomwaffen. Meine Begeisterung – gebe ich zu – entwickelte sich nur langsam. Ein besonderes Highlight war die Straßenaktion zur “sofortigen Abrüstung”. Meine Schwiegermutter buk gemeinsam mit anderen Kuchen und formte daraus Panzer und Kanonenrohre. Ziemliche große und hübsch verzierte Speise-Panzer wurden am Infotisch neben Unterschriftenlisten platziert. Jede und jeder konnte vor Ort einen Beitrag zur Abrüstung leisten – und ein (mundgroßes) Stück vom Panzer vernichten. Ich hatte meine Zweifel, aber ziemlich viele Leute auf der Straße entpuppten sich doch tatsächlich als AbrüstungsbefürworterInnen.
Insgesamt gelang es Edith, mit diesen Aktivitäten viele Frauen in der SPÖ-Frauenorganisation für die Anliegen der Friedensbewegung zu öffnen und ansprechbar zu machen – auch für heikle Dinge. Meine Schwiegermutter war nämlich, als eine der wenigen SPÖ-Nationalratsabgeordneten, Erstunterzeichnerin des Linzer Appells. Darin wurde die österreichische Regierung aufgefordert, sich gegen die Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa auszusprechen. Die SPÖ hielt den Appell zwar für “wertvoll”, aber “ergänzungsbedürftig”[5]. Bei den SPÖ-Friedensstrick- und stickrunden wurden Unterschriften für den Appell gesammelt. Es waren vielleicht frühe Erfolge von Guerilla Knitting und Radical Stitching: (Strick-)Anleitungen gegen Parteidisziplin.
Der Parteivorstand war nämlich weniger open-minded und fand die Friedensbewegung der Gefahr der Einseitigkeit, der Instrumentalisierung durch die KommunistInnen und des Anti-Amerikanismus ausgesetzt. Obwohl sich die Friedensbewegung nicht gegen die USA, sondern gegen deren Rüstungspolitik aussprach, und KommunistInnen sich gleichermaßen mit ChristInnen engagierten, nahm die SPÖ diese Argumente zum Anlass, offiziell von einem Aufruf Abstand zu nehmen und sich gegen eine aktive Beteiligung auszusprechen. Der Bundesparteivorstand beschloss, eine Teilnahme von einer Änderung der Plattform abhängig zu machen und forderte, dass es keine “einseitigen Losungen” geben dürfte.[6]
In der Tribüne, einer Zeitschrift von SPÖ-Linken, wurde dieser Beschluss heftig kritisiert. Er sei der “Versuch einer Partei, einer großen parteiübergreifenden Bewegung Vorschriften über ihre Inhalte zu machen, (der) scheitern müsse”. Die Autoren warfen der eigenen Partei vor: “Jedes Wegentwickeln aus den Grenzen bürokratischer Verfügungsgewalt wird daher per se als Feindstellung eingeschätzt, ohne die potentiell bündnisfähigen Inhalte zu analysieren. Sich politisch mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen, darauf sind die Genossen des Parteivorstandes wohl noch nicht gekommen.”[7]
Johanna Dohnal forderte genau diese Auseinandersetzung ein und drängte die GenossInnen dazu, sich in und mit der Friedensbewegung zu engagieren. Was die immer wieder problematisierte Teilnahme von KommunistInnen betraf, formulierte sie bestechend: “Deren aktive Teilnahme an Demonstrationen ist aber keinesfalls zu verhindern. Man kann schließlich nur schwer vor einer Veranstaltung das Parteibuch der Teilnehmer überprüfen.”[8]
Immerhin beschloss die Wiener SPÖ-Frauenorganisation einen offiziellen Aufruf und erwirkte damit auch, dass der zeitgleich tagende Wiener Landesparteitag frühzeitig beendet wurde, damit die Delegierten am Friedensmarsch teilnehmen konnten[9]. Unter dem Motto “Den Atomkrieg verhindern! Abrüsten!” fand die erste große gesamtösterreichische Friedensdemonstration am 15. Mai 1982 in Wien statt und ich war dabei – beim Friedensmarsch der 70.000.
Wir reisten zu Tausenden aus Oberösterreich mit Sonderzügen an, und Wochen davor war dieses Ereignis unser ständiges Gesprächsthema. Wir hatten ja eine Botschaft – und mussten sie verteidigen gegen den Vorwurf der Naivität, der Ahnungslosigkeit, der kommunistischen Verblendung, im Elternhaus, gegen konservative Professoren und gegen Typen in Krokodil-Polos mit hochgestelltem Kragen in der Schule. Und das tat ich mit der Leidenschaft einer Missionarin. Meine Aufsätze in Deutsch ähnelten eher Pamphleten oder militärstrategischen Abhandlungen, und jede Themenvorgabe versuchte ich auf die Friedensfrage hinzubiegen. Denn Ahnungslosigkeit und Naivität wollte ich mir von “denen” nicht unterstellen lassen.
Wir studierten Aufrufe, Fachartikel und später die Argumentationsbroschüre zum Linzer Appell. Wir konnten erklären, dass der 1979 gefasste sogenannte NATO-Doppelbeschluss ein Gesprächsangebot an die Sowjetunion unter Aufrüstungsandrohung stellte und wozu die 108 Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II und 464 Marschflugkörper auch Cruise Missiles genannt, technisch in der Lage waren. Wir kannten die Reichweiten der sowjetischen SS-20 und die Atombombenziele in Österreich nach dem US-Operationsplan 100-6. Erstschlagsstrategie, Gleichgewicht des Schreckens, ein begrenzter Atomkrieg – wir wussten, was davon Propaganda und was bedrohlich war. Für Friedensbewegte sprachen wir ziemlich viel über TNT, Trägerraketen und Sprengköpfe. Der Friede im Kleinen? “Was nutzt der Friede im Haus, wenn die ganze Menschheit am Atomkrieg krepiert.” – Broschüre zum Linzer Appell, Seite 17. Touché.
Die Schülerzeitung machten wir zum Zentralorgan der Friedensbewegung und druckten Analysen und Aufrufe darin ab, aber auch eine Kontroverse pro und contra Bundesheer. Vorausgegangen war dem eine heftige, wochenlange Debatte über die Sinnhaftigkeit der militärischen Landesverteidigung und die Frage, was man der Kriegslogik entgegensetzen konnte. Im schuleigenen Raucherhof (den man mit einem Raucherpass betreten durfte!) entwickelten wir Schülerzeitungsredakteurinnen im Streitgespräch mit Burschenschaftern unseren pazifistischen Standpunkt. Zugegebenermaßen waren gerade die Anhänger der schlagenden Verbindungen eine extrem schwierige Zielgruppe, und unsere Überzeugungskraft war enden wollend.
Die Kontroversen um Sinn und Unsinn des Bundesheeres und der Wehrpflicht, die wir im Bretterverschlag des Schulhofes führten, waren oft verknüpft mit der Frage, ob Frauen ins Bundesheer sollten oder nicht, und die Burschenschafter, mit denen wir stritten, entdeckten in diesem Feld die Gleichberechtigung. Es blieb ihr einziges – unnötig zu erwähnen. Natürlich waren wir gegen Frauen ins Bundesheer, wir waren ja auch dafür, das Bundesheer abzurüsten. Emanzipation durch “Waffen-Gleichheit”? Nicht mit uns.
Keine Frage, wir haben damals im Schulhof und bei Straßenaktionen mit Parolen um uns geschmissen: “Mit Krieg kann man keinen Frieden herbei bomben!” und “Die Sprache der Waffen ist das Ende der Politik” lauteten manche unserer Stehsätze. Aber wir haben dabei Positionen entwickelt und Argumentationen durchdacht. Wir diskutierten über friedliche Konfliktlösungen, über militärische Einsätze und hohe Wiederaufbaukosten. Wir debattierten beim Flugblattverteilen über die NATO und eine soziale Sicherheitsordnung, die nicht militärisch gedacht war. Wir zitierten beim Unterschriftensammeln Zahlen, wonach es in den letzen 2.500 Jahren “1656 Versuche gab, durch Wettrüsten den Frieden zu bewahren und dies 1640mal zum Krieg und in den anderen Fällen zum wirtschaftlichen Ruin der Beteiligten führte”.[10] In der Frauengruppe haben wir uns kühn über Straßentheater gewagt und sind in der Linzer FUZO und auf der Wiener Kärntnerstraße als Pershing-Zielscheibe auf Asphalt gelegen. Wir haben über Frieden geredet und über Formen der sozialen Verteidigung. Wir haben uns bei SPÖ-Veranstaltungen gegen Zeit-Soldaten und für umfassende Friedenserziehung in allen gesellschaftlichen Bereichen stark gemacht. Wir haben den Ausschluss von Frauen in Friedensprozessen kritisiert.
Von heute aus betrachtet haben wir ständig über Friedensfragen, Rüstungsabbau und alternative Verteidigungskonzepte geredet. Vielleicht täuscht die Erinnerung da etwas. Vielleicht täuscht sie auch deswegen, weil in den letzten Jahren mehr über Profiheer, Ausweitung der Wehrpflicht und die Festung Europa geredet wird. Über Entmilitarisierung und Abschaffung des Bundesheeres wird wenig geredet und schon gar nicht abgestimmt.
2001 hat Johanna Dohnal es so beschrieben:
„Das gegenwärtige Wiedererstarken männlicher Werthaltungen und traditioneller Rollenbilder geht einher mit Xenophobie, Nationalismus, Sexismus und Sozialabbau, mit dumpfem Populismus und Provinzialismus, mit Militarismus und der Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit.“
In ihrer letzten für den 21. Februar 2010 vorbereiteten (allerdings nicht mehr gehaltenen) Rede sagte sie:
“Die Sozialdemokratie hat seit jeher den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Alles was in ihr politisch tätige Menschen tun, sollten sie danach überprüfen: was mehr Gerechtigkeit schafft und Solidarität fördert. Das klingt in Zeiten wie diesen vielleicht altmodisch, aber ich bin davon überzeugt, dass es der einzige Weg ist um faire Lebenschancen für die Menschen zu ermöglichen. In diesem Sinn Freundschaft!”
Heute ist der 14. Februar 2016. Es wäre der 77. Geburtstag von Johanna Dohnal. Angesichts ihrer Klarheit beim Denken und ihrer Ausdrucksstärke, ihrer Bereitschaft, den Überzeugungen auch konkrete Taten folgen zu lassen, wird besonders schmerzhaft spürbar, wie sehr sie – nicht nur in der SPÖ - fehlt.
[1] Mira Lobe: Die Räuberbraut. Wien und München, Jugend und Volk, 1974
[2] “Zwischen Sozialismus und Diktatur gibt es keine Gemeinschaft, daher sind die Sozialisten unbeugsame und kompromißlose Gegner des Faschismus wie des Kommunismus.” – Vgl. Teuschler, 645. Hintergründe dazu im online-Lexikon der SPÖ Steiermark: http://www.stmk.spoe.at/steiermark/service/lexikon [Datum des Zugriffs: 25.12.12]
[3] Christine Teuschler, Friedensarbeit und Einstellung zum österreichischen Bundesheer, in: Beharrlichkeit, Anpassung und Widerstand, Die Sozialdemokratische Frauenorganisation und ausgewählte Bereiche sozialdemokratischer Frauenpolitik. 1945-1990, Wien 1993, 603-672, 638.
[4] Nicht wenige SPÖ-Frauenorganisationen finanzierten ihre Aktivitäten damit, dass sie das Jahr über Basteleien, Strickwaren oder Ähnliches herstellten und diese dann auf Adventmärkten verkauften. Manche SPÖ-Frauengruppen taten leider eben nur das. Daher standen sie unter entsprechend unpolitischem Ruf.
[5] Vgl. Alfred Gusenbauer, Die österreichische Friedensbewegung, Dissertation, Wien, 1987, 176.
[6] Gusenbauer, 83.
[7] Gusenbauer, 96f.
[8] Teuschler, 646f.
[9] Vgl. Teuschler, 645.
[10] Vgl. Argumentationshilfe zum Linzer Appell, 3. Verfügbar unter: http://www.erinnerungsort.at/thema7/u2_images/bild9.pdf
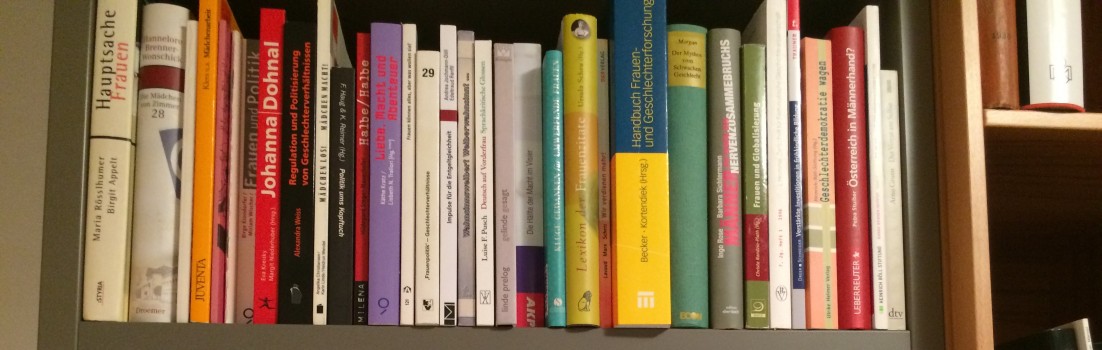
3. Oktober 2016 um Uhr
Sonja, ich bin begeistert von diesem (auch literarisch hochwertigen) Text!
Manfred (=Schröder, aber das weißt Du ja eh)
29. Oktober 2016 um Uhr
Danke, lieber Manfred:)!